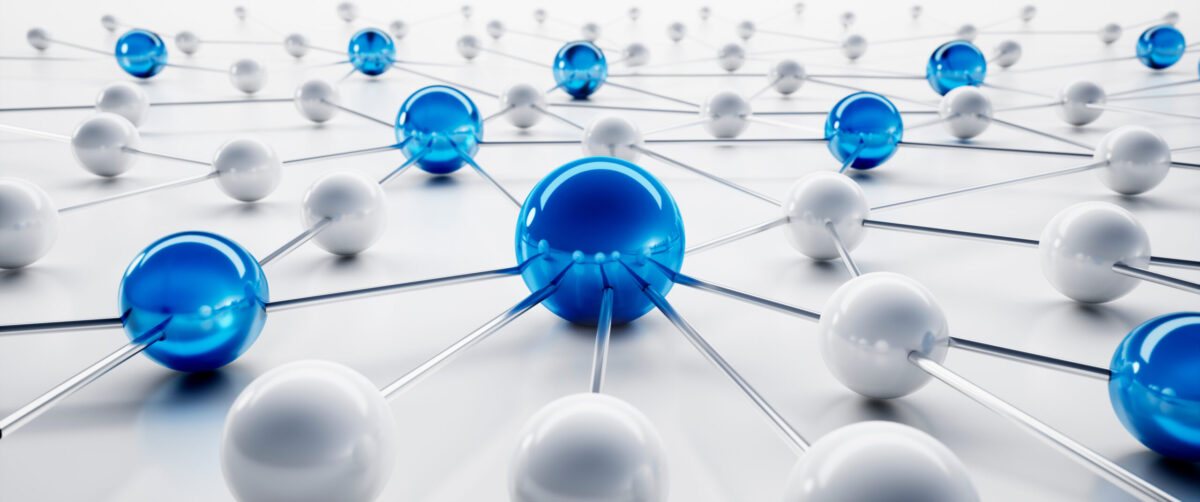Das neue PARKLINK-Netzwerk am LMU Klinikum München
München. Derzeit leben in Deutschland rund 400.000 Menschen mit der Parkinson-Krankheit – eine fortschreitende Erkrankung, die neben den motorischen Kardinalsymptomen Bewegungsarmut, Muskelsteifigkeit, Ruhezittern und Haltungsstörungen eine Vielzahl weiterer nicht-motorischer Symptome hervorruft, die die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen können.
Dank innovativer Behandlungsansätze ist es heute möglich, die Symptome wirksam zu lindern. Allerdings: Nicht alle Regionen in Bayern haben die Möglichkeit, eine eigene spezialisierte Fachabteilung oder Klinik für eine individuelle und hochwertige medizinische Betreuung von Parkinson-Patientinnen und -Patienten vorhalten zu können. Um diese Lücke zu schließen und den Betroffenen eine optimale, heimatnahe Versorgung zu bieten, die gleichzeitig an die Expertise eines Universitätsklinikums angebunden ist, wurde das Kooperationsnetzwerk PARKLINK gegründet: eine Zusammenarbeit von bislang 11 Kliniken aus Ober- und Niederbayern, der Oberpfalz und Oberschwaben, die von der Neurologischen Klinik und Poliklinik des LMU Klinikums initiiert wurde.
Neue Therapien wie die Tiefe Hirnstimulation
„PARKLINK verbindet moderne, leitlinienbasierte Parkinson-Therapie mit neuesten Forschungserkenntnissen. Einheitliche Standards ermöglichen den Zugang zu innovativen Diagnostik- und Behandlungsverfahren“, erklärt Prof. Günter Höglinger, Direktor der Neurologischen Klinik am LMU Klinikum. Dazu gehören modernste bildgebende und laborchemische diagnostische Untersuchungen und auch so fortschrittliche Therapieoptionen wie die Therapie mit Arzneimittelpumpen für eine konstante Medikamentenzufuhr oder die Tiefe Hirnstimulation: „Für Parkinson-Patienten, bei denen Medikamente nicht mehr ausreichen, kann die Tiefe Hirnstimulation eine wirksame Alternative sein. Denn mithilfe von elektrischen Impulsen im Gehirn lindert das Verfahren sehr effektiv motorische Symptome. Dank moderner Technologien und verträglicher Narkoseverfahren wird die Behandlung heute besonders schonend durchgeführt“, erklärt der Koordinator von PARKLINK und Leiter der Ambulanz für Tiefe Hirnstimulation, Pumpentherapie und Parkinson-Komplexbehandlung an der Neurologischen Klinik des LMU Klinikums, PD Dr. Thomas Köglsperger.
Digitale Medizin: Telemedizin und Wearables
Ob eine Tiefe Hirnstimulation – oder eine andere Behandlungsoption – im Einzelfall erfolgversprechend ist, wird mit Hilfe der Telemedizin in interdisziplinären Fallkonferenzen mit den Fachärzten der jeweiligen Partnerklinik erörtert und entschieden. „Wir können die Videoverbindung aber auch nutzen, um einen Hirnstimulator aus der Ferne präzise einzustellen“, sagt PD Dr. Köglsperger.
Neue digitale Technologien ermöglichen ebenfalls eine genaue Therapieanpassung und ortsunabhängige Betreuung der Parkinson-Patientinnen und Patienten. So erlauben etwa spezielle tragbare Bewegungssensoren – sogenannte Wearables – eine kontinuierliche Erfassung und Überwachung von typischen Parkinson-Beschwerden, um so zum Beispiel auf eine Verschlechterung oder starke Schwankungen zeitnah mit einer angepassten Therapie reagieren zu können.
Parkinson-Erkrankte, die von PARKLINK betreut werden, haben zudem die Möglichkeit, an Studien des LMU Klinikums teilzunehmen. Und da die Krankheit für die Angehörigen ebenfalls viele Veränderungen nach sich zieht, werden auch sie durch Schulungen aktiv eingebunden. Darüber hinaus bietet PARKLINK Weiterbildungen für Fachkräfte sowie regelmäßige Patienteninformationstage. Strukturierte Schulungen und einheitliche Qualitätsstandards gewährleisten, dass neueste Erkenntnisse direkt in die Praxis einfließen.
Quelle: LMU Klinikum
Weitere aktuelle Meldungen erhalten Sie über unseren KU Newsletter: Jetzt anmelden!