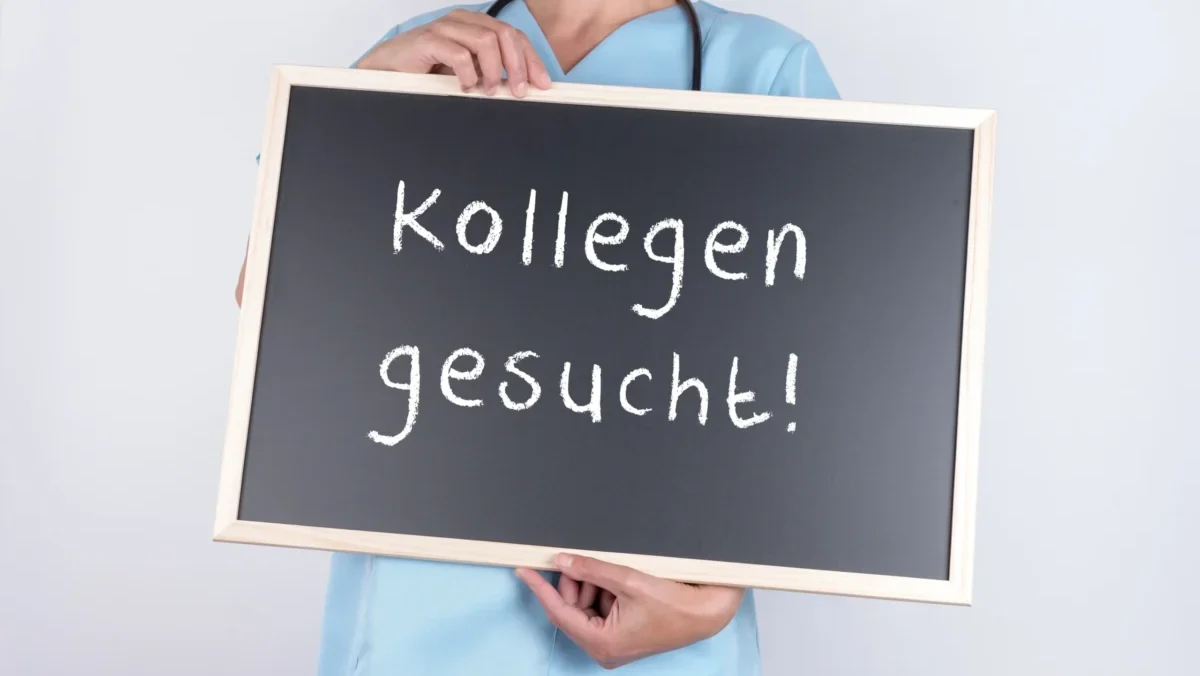Kennzahlen im Krankenhaus richtig verstehen
Wer Performance und Effizienz im Krankenhaus optimieren möchte, muss diese messbar machen. Dafür braucht es quantifizierbare Messgrößen, sprich: Kennzahlen. Sie sollen dem Krankenhaus-Controlling ein akkurates Bild der aktuellen Lage vermitteln, Schwachstellen transparent machen und strategische Entscheidungen vereinfachen. Aber welche Kennzahlen sind im Krankenhaus relevant? Wie entstehen sie? Und wie werden sie richtig interpretiert?
Allein haben Zahlen oft wenig Aussagekraft. Ist etwa ein Wert von durchschnittlich 1.900 belegten Betten eines Krankenhauses positiv zu bewerten oder nicht? Kommt darauf an: Ein Krankenhaus mit 2.000 Betten dürfte mit dieser Auslastung zufrieden sein, ein 4.000-Betten-Haus eher nicht. Aber selbst die beachtliche Bettenauslastung von 95 Prozent beim 2.000-Betten-Haus kann täuschen: Denn liegt die Verweildauer der Patienten über der mittleren Verweildauer der InEK-Kalkulation, können die Erlöse womöglich den erbrachten Aufwand gar nicht ausgleichen. Wenn der Medizinische Dienst in der Folge auch noch Leistungen kürzt, steht trotz guter Belegung unter dem Strich ein fettes Minus – trotz der vermeintlich guten Bettenbelegung.
Dies zeigt: Aussagekraft erhalten Kennzahlen erst dann, wenn sie miteinander in Beziehung gesetzt werden: die absolute Zahl belegter Betten mit der Gesamtzahl der Betten, diese Kennzahl mit der durchschnittlichen Verweildauer von Patienten im Haus – und diese wiederum mit der vom InEK vorgesehenen Verweildauer. Kennzahlen – oder auch KPI (Key Performance Indicators) – sind in diesem Sinne Kennzahlensysteme: sinnvoll verknüpfte Werte, die Abhängigkeiten sichtbar machen und ein aussagekräftiges Bild über die Performance eines Krankenhauses und seiner Fachbereiche vermitteln.
Die wichtigsten Kennzahlen-Arten
Es gibt eine ganze Reihe von Kennzahlen-Arten, mit denen sich der Krankenhausbetrieb abbilden lässt:
- Leistungskennzahlen wie Fallzahlen, CM-/DM-Punkte, Verweildauer oder Bettenauslastung beziehen sich auf das operationale Ergebnis.
- Finanzkennzahlen wie EBIT/Rendite, Investitionsquote, Eigenkapitalquote und Liquiditätsgrad messen die Wirtschaftlichkeit und identifizieren finanzielle Risiken.
- Produktivitätskennzahlen wie medizinischer Bedarf pro Fall, Erlöse pro Fall oder die Betriebsleistung pro Vollkraft verknüpfen Leistungs- mit Finanzkennzahlen.
- Qualitätskennzahlen wie Infektionsrate, Komplikationsrate, Sterblichkeitsrate, Fluktuation und Fehlzeitenquote überwachen die Qualität der Patientenversorgung.
- Prozesskennzahlen wie Durchlauf- und Wartezeiten, OP-Auslastung oder präoperative Verweildauer machen die Ablaufeffizienz sichtbar, um Prozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen.
Welche Kennzahlen am besten zur Erfolgssteuerung eines Krankenhauses beitragen, ist abhängig von den konkreten Zielen, Leistungen und Gegebenheiten vor Ort. Um die eigenen Unternehmensziele realistisch abzubilden, sollte eine ausgewogene Bandbreite zwischen diesen verschiedenen Kennzahlen-Arten etabliert werden.
Krankenhaus-Kennzahlen entwickeln in sechs Schritten
Steuerungsrelevante Kennzahlen entstehen in einem kontinuierlichen Prozess:
- Zielbild: Kennzahlen festlegen. Kennzahlen werden aus den eigenen übergeordneten Zielen abgleitet. Während Ergebnisgrößen wie EBIT und Liquiditätsgrad allen Häusern essentielle operationale Hinweise liefern, können andere Kennzahlen je nach Ziel spezifischer sein, etwa Personalkennzahlen wie Fluktuation oder Krankheitsquote.
- Dokumentation: Daten erfassen. Kennzahlen sind nur so gut wie die Datenqualität dahinter. Aber welche Daten werden benötigt und wie werden sie gewonnen? Und wer braucht später welche Kennzahlen für welche Steuerungsaufgaben?
- Datenmanagement: Daten nutzbar machen. Ein Data Warehouse kann als zentrale Datenquelle dazu beitragen, Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen, zu plausibilisieren und zu vereinheitlichen.
- Datenanalyse: Daten auswerten. Mithilfe statistischer Erhebungen, Trendanalysen und Benchmarking können Daten interpretiert werden. Für aussagekräftige Vergleiche kann der Rückgriff auf externe Analysetools sinnvoll sein.
- Visualisierung: Zusammenhänge darstellen. Ob als Ergebnis-Präsentation oder digitales Dashboard: Ein verlässliches Berichtswesen hilft dabei, Kennzahlen verständlich zu machen, Risiken und Handlungsoptionen zu identifizieren.
- Qualitätssicherung: Umsetzung monitoren. Kennzahlen im Krankenhaus werden nicht einmal für alle Zeiten festgelegt. Ihre systematische Erfassung und Auswertung ist ein Prozess, der kontinuierlich hinterfragt: Passen unsere Ziele noch? Sind unsere Daten valide? Sind neue hinzugekommen? Kennen alle Beteiligten ihre Ziele und ihre Bedeutung? Regelmäßiges kritisches Überprüfen vermeidet Betriebsblindheit.
Autorinnen: Gabriele Tode und Lea-Maria Schlink, Expertinnen für Finanzcontrolling bei Accenture
Weitere aktuelle Meldungen erhalten Sie über unseren KU Newsletter: Jetzt anmelden!