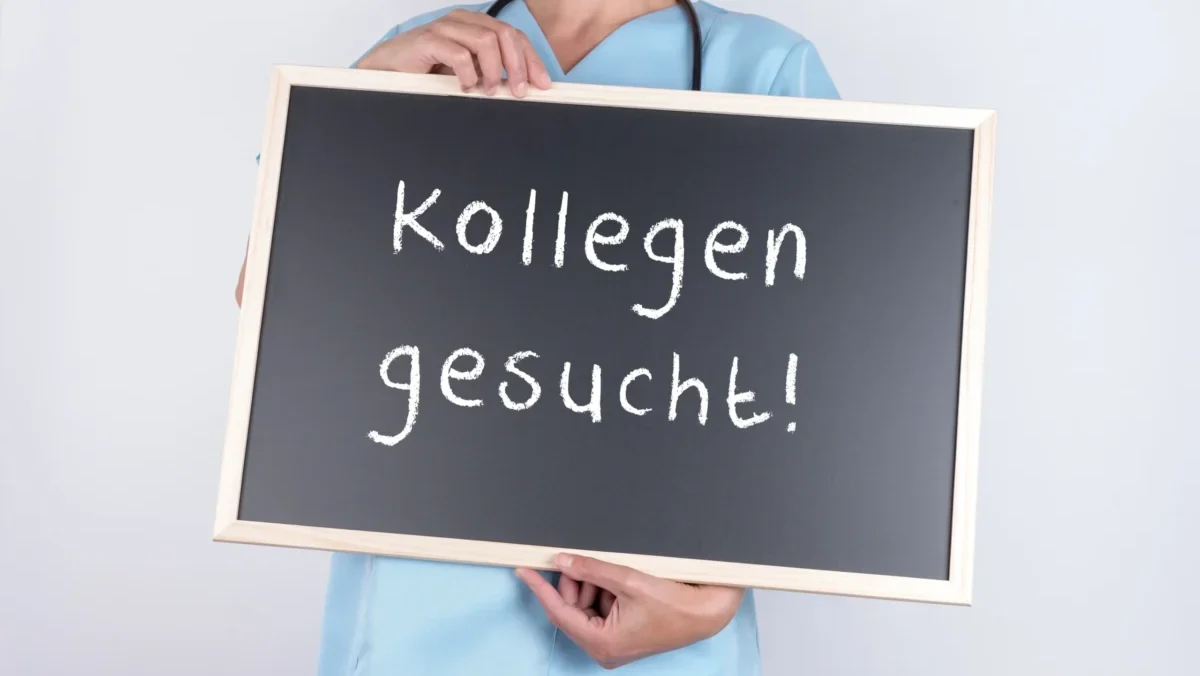Krankenhausinsolvenzen und die daraus erwachsenden Herausforderungen und Konsequenzen für das Controlling
Die Liquiditätssituation der Krankenhäuser in Deutschland spitzt sich weiter zu. Im Jahr 2023 haben 30 Krankenhäuser Insolvenz angemeldet, dreimal so viele wie 2022. Freigemeinnützige und private Krankenhäuser sind häufiger betroffen als öffentlich-rechtliche. Bereits bis Februar 2024 meldeten zehn Krankenhäuser Insolvenz an, und die Prognosen der Deutschen Krankenhausgesellschaft deuten darauf hin, dass sich die Anzahl der Krankenhausinsolvenzen in diesem Jahr verdoppeln könnte.
Ein Hauptgrund für diese Entwicklung ist die wachsende Erlös-Kosten-Schere. Erwartete Tarifsteigerungen um bis zu 10,5 Prozent und inflationsbedingte Kostensteigerungen von rund 2,6 Prozent führen zu einer deutlichen Belastung. Gleichzeitig liegt das Leistungsvolumen der Krankenhäuser etwa 13 Prozent unter dem Niveau von 2019. Die Refinanzierung der zusätzlichen Ausgaben kann nicht allein durch die Basisfallwertsteigerung von 5,13 Prozent im Jahr 2024 gedeckt werden. Zudem laufen die staatlichen Finanzhilfen aus, die in den letzten Jahren die Kostensteigerungen kompensiert haben.
Um Liquiditätsengpässen vorzubeugen, bleibt die Verkürzung der Zahlungsfrist der Krankenkassen auf fünf Tage, eingeführt durch das COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz auch 2024 bestehen, jedoch nur bis zum 31. Dezember. Der aktuelle Entwurf des KHVVG sieht vor, diese Verkürzung beizubehalten.
Regulatorische Anforderungen an die Liquidität
Für eine effektive Liquiditätssteuerung müssen Krankenhäuser die geltenden regulatorischen Anforderungen beachten, darunter die Zahlungsziele der Krankenkassen und die Insolvenzantragspflicht nach §18 InsO, die einen Prognosezeitraum von 24 Monaten vorsieht. Die Finanzierungsbasis muss für mindestens zwölf Monate sichergestellt sein.
Liquiditätssteuerungsinstrumente
Der steigende Liquiditätsdruck und die regulatorischen Anforderungen erfordern den Einsatz wirksamer Liquiditätssteuerungsinstrumente, die einen Ausblick in die Zukunft ermöglichen und auch kurzfristige Engpässe aufzeigen. Eine umfassende Steuerung erfolgt idealerweise auf drei Ebenen: Plan, IST und Prognose.
- Liquiditätsplanung: Abgeleitet aus der Wirtschaftsplanung, umfasst diese die erwarteten Zahlungsströme und berücksichtigt Sonder- und Saisoneffekte auf Monatsbasis.
- IST-Liquidität: Eine tägliche oder wöchentliche Rückschau auf die tatsächlichen Geldzuflüsse und -abflüsse.
- Liquiditätsprognose: Dynamisch fortgeführt, um laufend das Liquiditätsrisiko zu bewerten.
Berichterstattung und Frühwarnindikatoren
Ein aussagekräftiges Berichtswesen beinhaltet neben der freien Liquidität auch Frühwarnindikatoren. Dies sind Kennzahlen und Schwellenwerte, die Hinweise auf ein mögliches bevorstehendes Liquiditätsproblem geben. Beispiele sind der Einsatz von Fremdpersonal, der Krankenstand der Kodierfachkräfte und die durchschnittliche Dauer bis zur Abrechnung. Insgesamt sollte der Bestand der freien Liquidität mindestens so hoch sein wie ein durchschnittlicher Aufwandsmonat (bezogen auf Personal- und Sachaufwand), um einen entsprechenden Puffer vorzuhalten.
Liquiditätssteuerung als Gemeinschaftsaufgabe
Die Liquiditätssteuerung ist eine Querschnittsaufgabe, die eine Zusammenarbeit aller Funktionen im Krankenhaus erfordert. Das Controlling bündelt die Informationen und erstellt die Prognosen, wobei es auf die fristgerechte Bereitstellung von Daten durch Abteilungen wie Personal, Einkauf und Medizincontrolling angewiesen ist.
Fazit
Angesichts des steigenden Liquiditätsdrucks ist der Einsatz wirksamer Liquiditätssteuerungsinstrumente unverzichtbar. Diese Instrumente müssen kontinuierlich angepasst und um aktuelle Informationen ergänzt werden. Eine tägliche Betrachtung der Liquiditätssituation ist dabei besser als eine monatliche, und ein pragmatischer Ansatz ist besser als keiner. Die krankenhausweite Sensibilisierung für die Liquiditätswirksamkeit einzelner Tätigkeiten ist von großer Bedeutung, um wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten.
Angepasster Artikel aus KU Gesundheitsmanagement Ausgabe 05-2024
Entdecken Sie die ausführliche Variante in unserem KU-Archiv
Autorinnen: Janine Eulert und Maren Wünsch